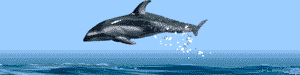Steinfisch
(Engl.: stonefish)
Der Name „Steinfisch“ beschreibt zutreffend das Aussehen dieses Fisches. Seine kompakte, plumpe Körperform, die raue, oft fetzig sich ablösende haut, von Algen bewachsen, und seine dem Untergrund hervorragend angepasste Färbung macht eine Unterscheidung von einem Stein oder einem Klumpen Schlamm schwer. Sie sind nicht selten, fallen aber durch ihre Tarnfärbung nicht auf und sind daher nur schwer zu finden.
Verbreitungsgebiete:
In allen Gegenden des Indo-Pazifiks weit verbreitet.
Vergiftungsumstände:
Die meisten Unfälle mit Steinfischen geschehen beim Waten im seichten Wasser, beim Herunterspringen vom Tauchboot in flaches Wasser, aber auch beim Wandern bei Ebbe über die Riffplattform. Wo der Fisch in kleinen Wasserpfützen zwischen Steinen liegen kann. Seiner Tarnung trauend, bleibt er an Ort und Stelle, wobei man leicht auf ihn und damit in die aufgestellten Rückenstacheln tritt.
Vorsichtsmaßnahmen:
Neben besonderer Vorsicht beim Waten im seichten Wasser stellen Schuhe zwar einen gewissen Schutz dar, doch können die kräftigen Stacheln der Rückenflosse auch die Sohlen eines Strandschuhes oder Füsslings durchdringen. Hat man einen Steinfisch entdeckt, so sollte man nicht versuchen, ihn mit den Händen zu ergreifen. Die Tiere selbst verhalten sich in aller Regel ruhig und greifen einen Taucher oder Schwimmer nicht an.
Wie beim Rotfeuerfisch (siehe da) sind die gleiche Anzahl von Strahlen an der After- und Bauchflosse sowie 13 kurze, aber kräftige Stacheln der Rückenflosse vorhanden, die mit großen Drüsenpaketen versehen sind, aber von allen Fischen ist der Steinfisch mit dem am besten entwickelten Giftapparat versehen.
Vergiftungserscheinungen:
Beim Eindringen des Stachels in einen anderen Körper wird die dicke Haut, die die Drüsen und den Stachel umgibt, zurückgeschoben, die Drüsen durch den auf sie einwirkenden Druck entleert und das Gift in die Wunde injiziert. Hierzu muss der Stachel etwa 0,6 bis 1,0 cm eindringen.
Die Strahlen der Brustflosse, aber auch die Knochendorne, die auf dem Kopf sitzen, stehen nicht mit den Giftdrüsen in Verbindung.
Jede der Giftdrüsen der Rückenstacheln enthält etwa 0,03 ml Giftflüssigkeit und 3 mg Trockengift. Es stellt ein Gemisch von hochtoxischen Proteinen dar.
Steinfisch-Verletzungen sind extrem schmerzhaft. Schon kurz nach dem Eindringen des Stachels setzt ein starker, brennender Schmerz ein, der sich in den folgenden Stunden, ja sogar ein bis zwei Tage anhalten kann. Leichzeitig entwickelt sich um die Einstichstelle ein Ödem, das auf die gesamte Extremität übergeht. Die Haut ist gerötet, mitunter bilden sich Hautblasen und kleine Wundnekrosen.
Auf Grund der starken Schmerzen kann es zu irrationalen, hysterischen Reak-tionen des Verletzten kommen. Begleitsymptome, wie allgemeines Schwächege-fühl, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, Herzklopfen; Pulsarrhythmen bis hin zum Kreislaufkollaps müssen daher nicht unbedingt auf einer direkten Giftwirkung beruhen, sondern können auch Folge der Schmerzreaktionen sein. Der Heilungsprozess der Stichverletzung kann durch Sekundärinfektionen kompliziert werden.
Trotz allem sind Steinfisch-Vergiftungen keinesfalls so gefährlich wie vielfach angenommen. Es sind nur zwei Todesfälle beschrieben, beide Personen star-ben innerhalb einer Stunde. Neuere Berichte mit genauen klinischen Daten liegen nicht vor. Eine hohe Todesrate ist daher Steinfisch-Vergiftungen in keinem Fall zuzuschreiben.
Erste Hilfe:
- Wasser verlassen bzw. Verletzten aus dem Wasser bergen.
- Keine Staubinde anlegen.
- Wunde nicht einschneiden oder gar ausschneiden.
- Bei starken Schmerzen (bei den meisten Verletzungen der Fall) kann eine lo-kale Schmerzblockade mit Lodocain-Injektionen, deren Wirkung auch mehrere Stunden anhält, versucht werden.
- Zur Beruhigung des Verletzten kann ein Beruhigungsmittel eingesetzt werden.
- Die Heißwasser-Methode wird nicht empfohlen.
Umgehend Arzt aufsuchen:
Für Steinfisch-Vergiftungen steht ein Antiserum zur Verfügung.
Die Anwendung des Antiserums kann indiziert werden, wenn schwere Schmerzzustände oder gravierende Begleitsymptome auftreten. Bei leichten Verletzungen ohne starke Schmerzen oder bei länger zurückliegenden Verlet-zungen, aber inzwischen verbessertem Allgemeinzustand und Nachlassen der Schmerzen, soll auf die Antiserum-Anwendung verzichtet werden.
Bei tiefen Verletzungen kann es zur Sekundärinfektionen kommen, wenn z. B. abgebrochene Stacheln in der Wunde bleiben. Wenn möglich, ist die Wunde daraufhin zu sondieren. Antibiotika-Schutz ist empfehlenswert, Tetanusprophy-laxe falls erforderlich.
|